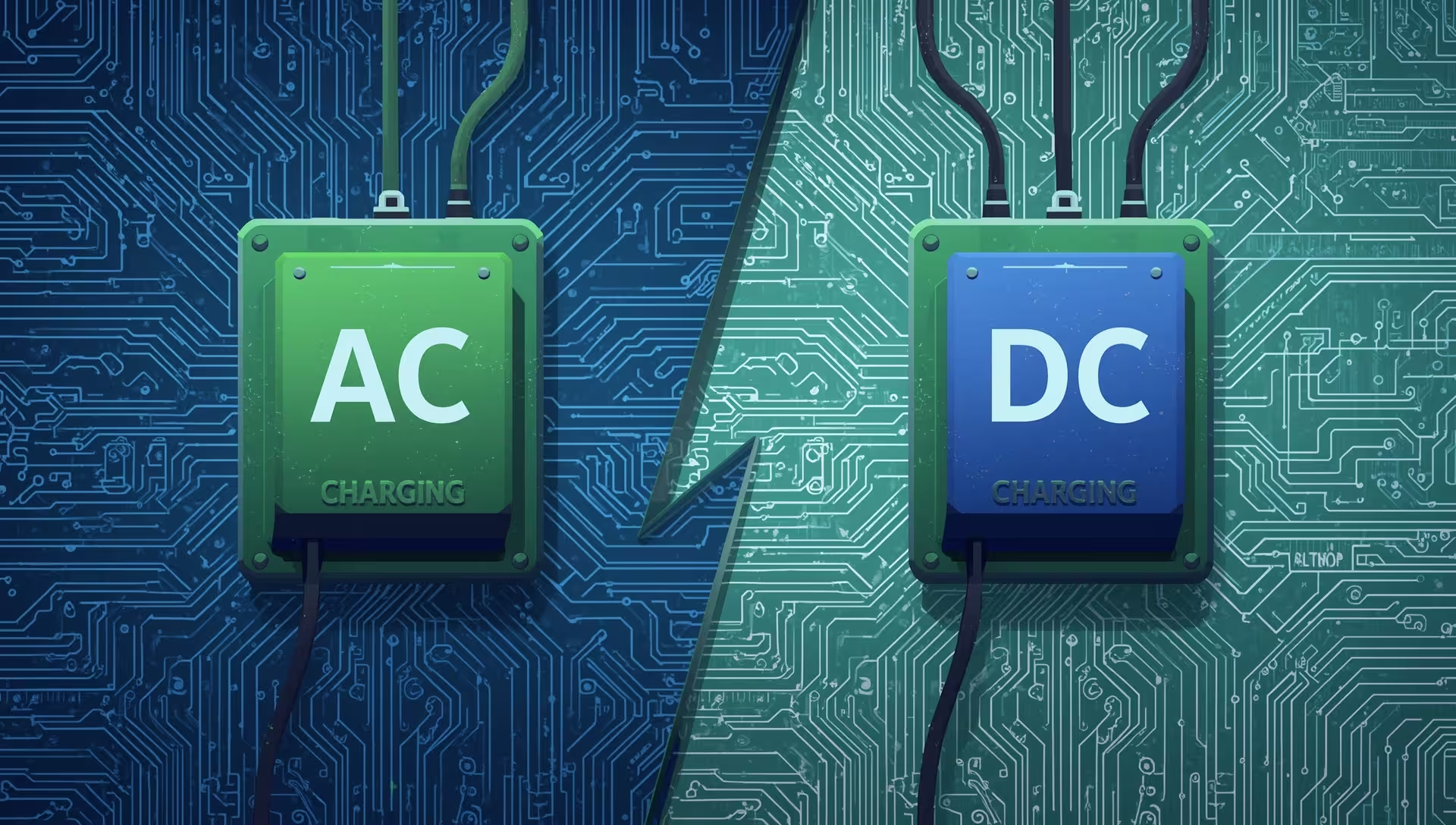Die Uhr tickt für den Verbrennungsmotor. In einer Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen auf die industrielle Identität Deutschlands hat, hat die Europäische Union eine feste Frist gesetzt: Ab 2035 dürfen neue Autos mit Verbrennungsmotoren (ICE) in der gesamten Union nicht mehr verkauft werden. Ist dies das Ende für den Verbrennungsmotor? Bei der Debatte über das Ende der Verbrennungsmotoren bis 2035 geht es nicht nur um die Umwelt, sondern auch um einen entscheidenden Moment für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, die technologische Souveränität und die Freiheit der Verbraucher. Der Ausdruck „Ende des Verbrennungsmotors 2035” unterstreicht die Dringlichkeit dieses Themas.
Deutschland, Heimat großer Automobilhersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW, hat ein großes Interesse an dieser Diskussion. Die aktuellen Fakten sind klar: Die Entscheidung der Europäischen Union, die Teil des Klimapakets „Fit for 55” ist, schreibt eine 100-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen von Neuwagen bis 2035 vor. Damit werden herkömmliche Benzin- und Dieselfahrzeuge praktisch verboten.
1. Die Rolle von E-Kraftstoffen (synthetischen Kraftstoffen)
Können synthetische Kraftstoffe den Verbrennungsmotor retten? Dies ist das wichtigste Stichwort für die Rettung, und für viele in der Branche ist es das letzte, schlagkräftige Argument für technologische Offenheit. Befürworter behaupten, dass E-Kraftstoffe einen Weg zu CO2-neutraler Mobilität bieten, ohne dass Millionen von Autofahrern ihre bestehenden Fahrzeuge oder Infrastruktur verschrotten müssen.
Wie wird CO2-neutraler E-Kraftstoff hergestellt? Eine technische Erklärung
E-Kraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe sind ein Produkt des Power-to-Liquid-Verfahrens (PTL). Sie können direkt als Ersatz für herkömmliches Benzin oder Diesel verwendet werden und ermöglichen so den Antrieb bestehender Verbrennungsmotoren ohne Modifikationen. Aus diesem Grund sind sie für den Großteil der bestehenden Fahrzeugflotte so attraktiv.
Der Prozess der Herstellung von CO2-neutralem E-Kraftstoff umfasst drei Hauptschritte:
- Wasserstoffproduktion: Durch Elektrolyse wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Entscheidend ist, dass dieser Prozess zu 100 % mit erneuerbarer Energie (z. B. aus Wind- oder Sonnenenergie) betrieben wird, um als „grün” und CO2-neutral zu gelten.
- Kohlenstoffabscheidung: Die Produzenten müssen Kohlendioxid (CO2) entweder direkt aus der Atmosphäre (Direct Air Capture, DAC) oder aus industriellen Punktquellen (z. B. Zementwerken) abscheiden.
- Synthese: Das abgeschiedene CO2 und der erneuerbare H2 durchlaufen eine chemische Reaktion (oft eine umgekehrte Wassergas-Shift-Reaktion oder Fischer-Tropsch-Synthese), um einen synthetischen Kohlenwasserstoff zu erzeugen. Dieser flüssige Kraftstoff funktioniert genau wie ein fossiler Brennstoff.
Vor- und Nachteile: CO2-Neutralität vs. Effizienz und Kosten
Die Debatte über E-Kraftstoffe dreht sich um ihre praktische Umsetzbarkeit. Eine kritische Bewertung zeigt sowohl überzeugende Vorteile als auch erhebliche Einschränkungen auf.
| Aspekt | E-Kraftstoffe (synthetische Kraftstoffe) | Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) |
| CO2-Bilanz | Geschlossener Kreislauf (die Produktion fängt das auf, was bei der Verbrennung freigesetzt wird). | Null Auspuff-Emissionen. Produktion und Netzenergie sind entscheidend (LCA). |
| Energieeffizienz | Extrem niedrig: Aufgrund mehrerer Umwandlungsverluste gelangen nur 10–25 % des ursprünglich erneuerbaren Stroms an die Räder. | Extrem hoch: 70–90 % der ursprünglichen elektrischen Energie gelangen an die Räder. |
| Kosten | Derzeit unerschwinglich teuer (2 bis 5 Euro pro Liter ohne Steuern) und wird aufgrund seiner Ineffizienz wahrscheinlich auch weiterhin ein Premiumprodukt bleiben. | Geringere Betriebskosten (günstiger pro km). Höherer Anschaffungspreis (der jedoch schnell sinkt). |
| Bestehende Infrastruktur | Perfekt kompatibel mit bestehenden Tankstellen, Logistik und Motorentechnologie. | Erfordert eine umfangreiche und kostspielige Einführung neuer Ladeinfrastruktur. |
| Umweltverschmutzung | Bei der Verbrennung werden weiterhin giftige Emissionen (giftige E-Kraftstoff-Emissionen) wie Stickoxide (NOx) und Partikel freigesetzt. | Null Auspuff-Emissionen. |
| Lautstärke & Priorität | Prognosen zeigen eine erhebliche Verknappung; bei der Produktion werden Luftfahrt und Schifffahrt (Sektoren, die schwer zu dekarbonisieren sind) Vorrang haben. | Die Herausforderungen in der Lieferkette konzentrieren sich auf Rohstoffe (Lithium, Kobalt). |
Die enorme Effizienz ist die größte Schwäche von E-Kraftstoffen für Personenkraftwagen. Mit derselben Menge an Ökostrom fährt ein BEV etwa vier- bis fünfmal weiter als ein mit E-Kraftstoff betriebenes Auto. Das macht sie zu einer wertvollen, knappen Ressource, die am besten für Sektoren reserviert wird, die nicht ohne Weiteres elektrifiziert werden können.
Die politische Ausnahme: Der EU-Kompromiss für E-Kraftstoffe nach 2035
In einer dramatischen Entscheidung in letzter Minute drohte das deutsche Verkehrsministerium unter Führung der Freien Demokratischen Partei (FDP) mit einem Veto gegen das gesamte Auslaufgesetz für 2035. Dieser politische Druck führte zu einem bedeutenden Kompromiss innerhalb der EU: Neuwagen mit Verbrennungsmotoren können auch nach 2035 noch zugelassen werden, sofern sie ausschließlich mit CO2-neutralen E-Kraftstoffen betrieben werden.
Die Europäische Kommission muss eine neue Fahrzeugklasse für diese Autos schaffen und Technologien vorschreiben, die verhindern, dass sie mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können. Diese Ausnahme ist ein klarer Sieg für das deutsche Konzept der „Technologieoffenheit” und bietet der Motorenbau- und Zulieferindustrie eine Rettungsleine. Ob Autokäufer jedoch ein seltenes, teures E-Fuel-Fahrzeug einem sich rasch verbessernden, kostengünstigeren BEV vorziehen werden, bleibt eine große offene Frage.
2. Alternative und Übergangstechnologien
Über Benzin und Diesel hinaus: Hybrid, Wasserstoff und Co. Der Fokus auf E-Kraftstoffe überschattet manchmal andere alternative Antriebe, die Zwischen- oder Nischenlösungen bieten. Eine umfassende Strategie muss alle wettbewerbsrelevanten Schlüsselbegriffe rund um alternative Antriebe über das Jahr 2035 hinaus berücksichtigen.
Hybrid und Plug-in-Hybrid: Eine Brückentechnologie mit Verfallsdatum?
Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) kombinieren einen Verbrennungsmotor mit einem Elektroantrieb. Sie haben eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Flottenemissionen gespielt und bieten Verbrauchern, die vor der Umstellung auf reine Elektrofahrzeuge zurückschrecken, eine Brücke. Aufgrund neuer Untersuchungen wird jedoch über die Zukunft von PHEVs diskutiert.
- Standard-Hybridfahrzeuge (HEV): Ihr Schicksal ist direkt mit dem Verbot von Verbrennungsmotoren verbunden, da sie die Vorgabe einer 100-prozentigen CO2-Reduzierung bis 2035 nicht erfüllen können.
- Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV): PHEVs bieten eine größere elektrische Reichweite, stehen jedoch in der Kritik, dass viele Fahrer, insbesondere Nutzer von Firmenwagen, sie selten aufladen und sie so effektiv wie weniger effiziente Benziner fahren. Neue EU-Vorschriften zur Messung der realen CO2-Emissionen (einschließlich des Fahrverhaltens bei leerer Batterie) machen sie für Hersteller kurzfristig weniger attraktiv. Die Europäische Kommission hat für 2026 eine Überprüfung der Vorschriften für 2035 geplant, wobei die Rolle von PHEVs eines der wichtigsten Elemente ist, die dabei berücksichtigt werden.
Auch wenn sie keine dauerhafte Lösung darstellen, bieten PHEVs dennoch einen erheblichen Mehrwert in Segmenten, in denen BEVs Schwierigkeiten haben, beispielsweise bei Nutzern mit hoher Kilometerleistung und begrenztem Zugang zu zuverlässigen Lademöglichkeiten.
Wasserstoffverbrennungsmotor: Eine Nische oder die letzte Chance?
Die Debatte um Wasserstoffverbrennung versus Brennstoffzellen definiert die echte Alternative zur Batterieversorgung:
- Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV): Diese Fahrzeuge nutzen Wasserstoff zur Stromerzeugung in einer Brennstoffzelle, wobei als Nebenprodukt lediglich Wasserdampf entsteht. Es handelt sich um Elektroautos mit einem Wasserstofftank anstelle einer großen Batterie. BMW ist ein deutscher Hersteller, der in diesen Bereich investiert, da er darin eine Option für Langstreckenfahrten und schnelleres Betanken sieht.
- Wasserstoffverbrennungsmotor: Bei dieser Technologie wird ein herkömmlicher Verbrennungsmotor so modifiziert, dass er reinen Wasserstoff verbrennt. Er behält den Klang und das Fahrgefühl eines Verbrennungsmotors bei, produziert jedoch fast kein CO2 (nur minimale Mengen aus der Verbrennung von Schmieröl) und wenig NOx. Der Nachteil ist die Effizienz und Komplexität.
Experten sehen für den Wasserstoff Verbrennungsmotor im Wesentlichen nur noch eine Nische Rolle vor, vor allem für Schwerlast Anwendungen (Lkw, Baumaschinen) oder Spezial Zwecke, da der FCEV-Weg trotz der großen Herausforderungen beim Aufbau eines Wasserstoff Tankstellennetzes einen sauberen und effizienten Antrieb für Pkw bietet.
Die Weiterentwicklung des klassischen Verbrennungsmotors
Die ICE bleibt vor Ablauf der Frist im Jahr 2035 nicht untätig. Deutsche Ingenieure investieren weiterhin in mehr Effizienz und Langlebigkeit. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf der Erfüllung der strengen künftigen Euro-7-Abgasnorm, die für kleine, erschwingliche Autos eine enorme technologische und finanzielle Hürde darstellt.
- Thermischer Wirkungsgrad: Fortschrittliche Techniken wie variable Verdichtungsverhältnisse und ein ausgefeiltes Wärmemanagement zielen darauf ab, den Wirkungsgrad von Hochleistungsmotoren über die 50-Prozent-Marke zu steigern.
- Reduzierte Emissionen: Die Hersteller verbessern Partikelfilter und Katalysatoren, sodass die aktuellen Verbrennungsmotoren selbst bei Betrieb mit fossilen Brennstoffen so sauber sind wie nie zuvor.
Für die bestehende Flotte – die Millionen von Autos, die auch nach 2035 noch auf deutschen Straßen unterwegs sein werden – sorgen diese Entwicklungen in Verbindung mit dem potenziellen Einsatz von E-Kraftstoffen für eine saubere und längere Lebensdauer.
3. Der Hauptkonkurrent: Elektromobilität
Warum E-Mobilität politisch bevorzugt wird: Der Kern der Verkehrswende ist die aggressive Umstellung auf Elektromobilität. Das einfache, nicht verhandelbare Ziel der Null-Auspuff-Emissionen macht Elektromobilität vs. Verbrennungsmotor zum zentralen Thema der politischen Strategie. BEVs bieten in Verbindung mit einem Stromnetz aus erneuerbaren Energien die sauberste Lösung und haben damit einen klaren politischen Vorteil bei der Erreichung ambitionierter Klimaziele.
Die Herausforderung der Ladeinfrastruktur und Reichweite
Zwar produzieren deutsche Hersteller mittlerweile BEVs von Weltklasse, doch bestehen weiterhin Probleme hinsichtlich der Reichweite und der Infrastruktur. Die Herausforderungen für die deutsche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge liegen weniger in der Anzahl der Ladestationen als vielmehr in deren Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit.
- Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während Autobahnraststätten über ein robustes und schnell wachsendes Netz von Schnellladestationen (HPCs) verfügen, mangelt es in vielen ländlichen Gebieten und älteren Wohngebäuden in Städten nach wie vor an bequemen Ladelösungen für Bewohner ohne eigene Garage.
- Netzstabilität: Die letztendliche Einführung von BEVs auf dem Massenmarkt erfordert massive Investitionen in die Modernisierung des bestehenden deutschen Stromnetzes, um Spitzenlasten beim Laden zu bewältigen, insbesondere in Ballungsräumen.
- Benutzererfahrung (UX): Verbraucher verlangen ein nahtloses Leseerlebnis – einheitliche Zahlungssysteme und zuverlässige Hardware sind unerlässlich, um die anfängliche Skepsis zu überwinden, die rch jahrzehntelanges einfaches Tanken entstanden ist.
Die ökologische Bilanz: Wo steht das batterieelektrische Fahrzeug (BEV)?
Eine kritische Betrachtung von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) beginnt oft mit einer entscheidenden Frage: Wie umweltfreundlich ist ein Elektroauto? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine ehrliche Ökobilanz (Lebenszyklusanalyse, LCA) durchführen. Der Herstellungsprozess, insbesondere der Abbau von Rohstoffen und der Energieverbrauch bei der Produktion von Batteriezellen, führt zunächst zu einem höheren CO2-Fußabdruck eines BEV im Vergleich zu einem ähnlichen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (ICE). Die Umweltbilanz eines Elektrofahrzeugs verbessert sich jedoch erheblich, sobald es auf der Straße unterwegs ist.
- Der Break-Even-Punkt: Studien zeigen übereinstimmend, dass ein Elektroauto, das mit dem deutschen Strommix (der von Jahr zu Jahr grüner wird) betrieben wird, nach etwa 50.000 bis 100.000 Kilometern den CO2-Break-Even-Punkt gegenüber einem herkömmlichen Verbrennungsmotor erreicht.
- Der Netzeffekt: Da Deutschland seine Stromerzeugung erfolgreich auf erneuerbare Energien umstellt, sinken gleichzeitig die Lebenszeit-Emissionen jedes BEVs auf der Straße. Ein BEV ist nur so sauber wie der Strom, der in seine Batterie fließt. Diese Dynamik macht die Elektrifizierung zu einem wirksamen Hebel für die Dekarbonisierung.
Wird das EU-Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2035 wirklich rückgängig gemacht werden?
Die politische Unsicherheit hält an. Die Frage, ob das EU-Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2035 rückgängig gemacht wird, ist eine häufig gestellte Frage, die die tatsächlichen Zweifel der Öffentlichkeit widerspiegelt.
Trotz Forderungen einiger politischer Parteien (wie der Konservativen) und Industrielobbys, die Regelung zu schwächen, sind sich Experten und Politiker einig, dass eine vollständige Rücknahme höchst unwahrscheinlich ist.
Das Gesetz ist in Kraft, und eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sowie eine wachsende Zahl deutscher Automobilhersteller (z.B. VW, Audi, Mercedes-Benz) haben bereits Milliardeninvestitionen in eine elektrische Zukunft zugesagt. Eine Aufhebung des Verbots würde:
- Die Glaubwürdigkeit der EU in Klimafragen massiv untergraben.
- Chaos für Hersteller verursachen, die ihre Fabriken bereits umgerüstet haben.
- Die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber schnell agierenden globalen Akteuren, insbesondere aus China, die den Markt für Elektrofahrzeuge dominieren, beeinträchtigen.
Das wahrscheinliche politische Ergebnis ist keine Umkehrung, sondern eine anhaltende Debatte über die technischen Details der E-Kraftstoff-Ausnahme und die mögliche Flexibilität für Plug-in-Hybride in der Überprüfung 2026.
4. Wirtschaftliche und industrielle Folgen
Was der Wandel für die deutsche Automobilindustrie bedeutet. Diese massive industrielle Umstellung ist mehr als nur eine regulatorische Veränderung; sie ist ein grundlegender Wandel für die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie.
Die Gefahr für Arbeitsplätze und Zulieferer
Der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf reine Elektrofahrzeuge stellt eine existenzielle Bedrohung für Deutschlands hochspezialisiertes und prosperierendes Ökosystem der Automobilzulieferer dar. Ein elektrischer Antriebsstrang enthält deutlich weniger Teile (etwa 90 % weniger bewegliche Teile) als ein komplexes Verbrennungsmotor- und Getriebe-System.
Die Auswirkungen der Elektromobilität auf deutsche Zulieferer sind gravierend:
- Risiko des Arbeitsplatzverlustes: Studien schätzen, dass bis zu einem Drittel der Arbeitsplätze in der deutschen Automobilbranche – potenziell über 600.000 direkte und indirekte Stellen – bis 2035 gefährdet sind, insbesondere in KMU der Metallverarbeitung und Komponentenfertigung, die sich auf ICE-Komponenten (z. B. Kraftstoffpumpen, Einspritzdüsen, Kolben) spezialisiert haben.
- Standortkonzentration: Diese Arbeitsplatzverluste sind nicht gleichmäßig verteilt, was zu einem starken sozialen und wirtschaftlichen Druck in Regionen führt, die stark von der traditionellen Komponentenfertigung abhängig sind.
Der Wandel erfordert massive Anstrengungen zur Umschulung und Diversifizierung der Arbeitskräfte. Die Frage ist, ob die neuen Arbeitsplätze, die in der Batterieherstellung, der Ladeinfrastruktur und der Softwareentwicklung entstehen, die Verluste im traditionellen Maschinenbau vollständig ausgleichen können.
Wettbewerbsfähigkeit im globalen Vergleich (Fokus auf China und die USA)
Der enge Zeitplan der EU zwingt deutsche Hersteller dazu, in einer globalen Landschaft aufzuholen, die zunehmend von zwei starken Konkurrenten dominiert wird:
- China: Chinesische Unternehmen wie BYD und CATL dominieren die Wertschöpfungskette im Bereich Batterien und produzieren zunehmend wettbewerbsfähige, kostengünstige Elektrofahrzeuge. Dank ihres schnellen Innovationszyklus und des immensen Umfangs ihres Binnenmarktes haben sie einen deutlichen Vorsprung im Segment der Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt.
- USA: Staatliche Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) schaffen einen starken Anreiz für Hersteller, in nordamerikanische Produktions- und Lieferketten zu investieren, wodurch Investitionen aus Europa abgezogen werden könnten.
Die globale Perspektive Deutschlands wird zusätzlich dadurch erschwert, dass der Verbrennungsmotor in vielen wichtigen Exportmärkten (Indien, Brasilien, Mexiko) nach wie vor die dominierende Technologie ist. Eine Einschränkung der Entwicklung und Produktion von Verbrennungsmotoren für den heimischen Markt könnte die Fähigkeit deutscher Hersteller beeinträchtigen, diese wichtigen globalen Segmente zu bedienen, und damit den Weg für außereuropäische Wettbewerber frei machen.
Die Forderung der Industrie nach technologischer Offenheit
Führende deutsche Industrieunternehmen, insbesondere solche mit globaler Präsenz wie BMW und Mercedes-Benz, fordern von der Politik kontinuierlich technologische Offenheit. Dies ist nicht unbedingt eine Ablehnung der Elektromobilität, sondern vielmehr die Forderung, dass mehrere Wege – darunter E-Kraftstoffe und Wasserstoff – miteinander konkurrieren dürfen.
Sie argumentieren, dass ein „Technologie Mandat“ (d. h. die ausschließliche Zulassung von BEVs) Innovationen hemmt, zu Markt Verkrustungen führt und die Branche anfällig für externe Schocks oder Probleme in der Lieferkette einer einzelnen Technologie macht. Für sie bietet der tatsächliche Wettbewerb den besten Weg zur Klimaneutralität und sichert gleichzeitig die Führungsrolle der deutschen Ingenieurskunst.
5. Schlussfolgerng
Der E-Kraftstoff-Kompromiss sorgt dafür, dass der Verbrennungsmotor 2035 nicht plötzlich komplett aussterben wird. Allerdings schränken Effizienz, Knappheit und Kosten die Verbreitung von E-Kraftstoff-Autos als Massenmarkt Alternative zu BEV stark ein. Der E-Kraftstoff-Antrieb wird wahrscheinlich eine Premium-Lösung für Spezialfahrzeuge, Oldtimer oder begrenzte Segmente bleiben und nicht die Rettung für die Volumenmodelle der Branche sein.
Der eigentliche Gewinner der Frist bis 2035 ist der Elektromotor. Die Entscheidung der EU hat die Investitionssicherheit geschaffen, die für eine Beschleunigung der Umstellung auf BEV erforderlich ist, und die deutsche Automobilindustrie zu einer raschen Umstellung gezwungen.
Häufig gestellte Fragen:
Kann ich mein bestehendes Diesel- oder Benzinauto nach 2035 in Deutschland weiterhin fahren?
Ja. Das Verbot betrifft nur den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Sie können gebrauchte Benzin- und Dieselautos weiterhin uneingeschränkt fahren, kaufen und verkaufen.
Wird E-Kraftstoff für meinen täglichen Weg zur Arbeit erschwinglich genug sein?
Unwahrscheinlich. Aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Herstellung (Ineffizienzfaktor) werden E-Kraftstoffe deutlich teurer bleiben als herkömmliche Kraftstoffe, insbesondere wenn man die unvermeidliche Priorisierung für Luftfahrt und Schifffahrt berücksichtigt.
Bedeutet der Kompromiss zum E-Kraftstoff, dass ich nach 2035 ein neues Standard-Benzin Auto kaufen kann?
Nein. Sie können nach 2035 nur dann ein neues Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zulassen, wenn es technisch so ausgelegt und gesetzlich zertifiziert ist, dass es ausschließlich mit CO2-neutralen E-Kraftstoffen betrieben werden kann. Standard-Benzin- und Dieselautos werden verboten.
Wie stehen deutsche Autohersteller zum Verbot von 2035?
Sie sind geteilter Meinung. Volumenhersteller wie VW und Audi haben sich weitgehend für die Umstellung auf Elektroantriebe entschieden und sich auf interne Fristen vor 2035 gesetzt. Premiummarken wie BMW und solche, die Spezialmärkte bedienen (Porsche mit E-Kraftstoffen), drängen auf technologische Offenheit und plädieren für die parallele Existenz mehrerer Antriebskonzepte.